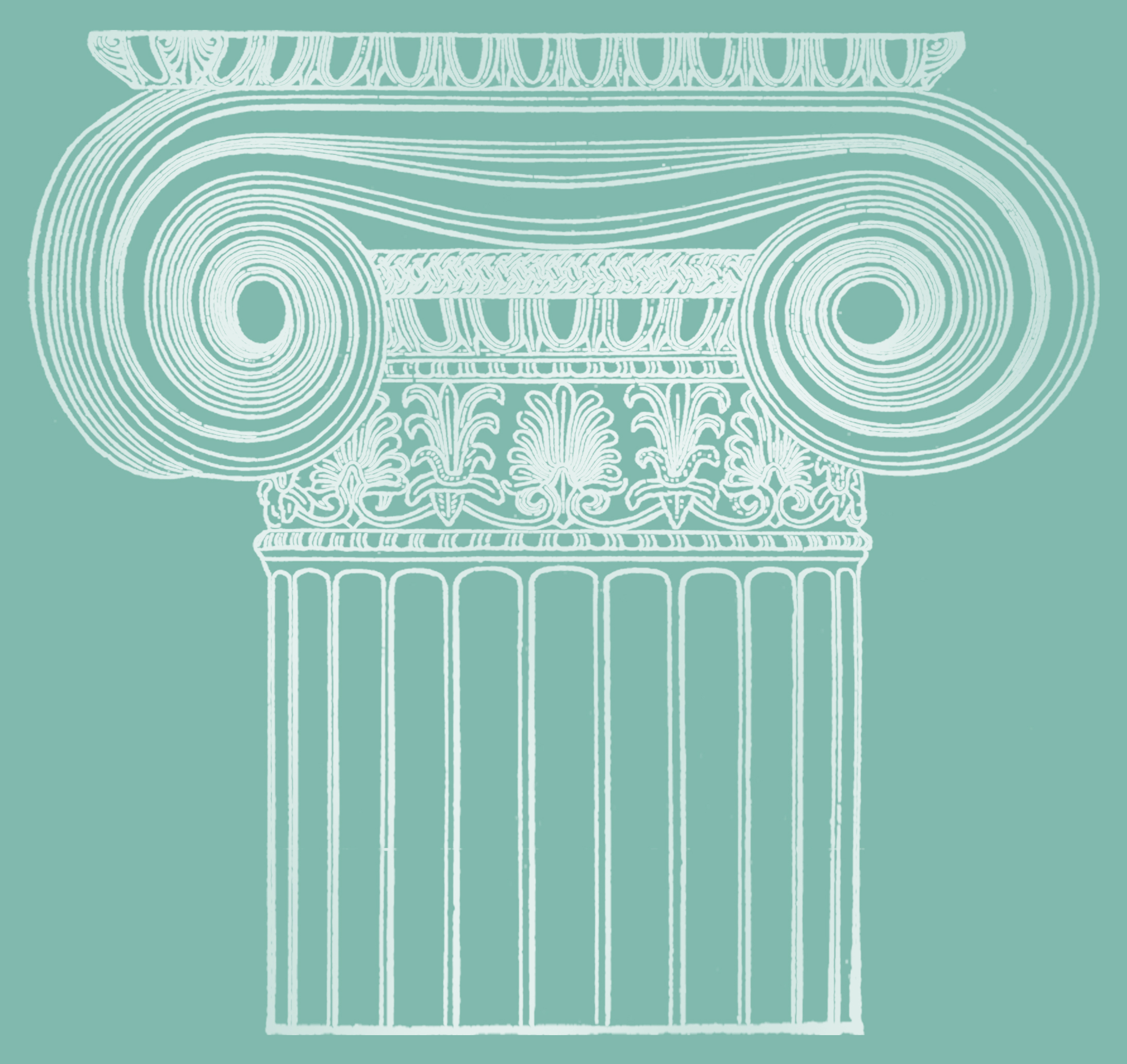Hans Gangoly
STADTREPARATUR UND STADTVERDICHTUNG
Der Grazer Architekt Hans Gangoly schafft es, Altes und Neues zu einem Ganzen zu verbinden, zu homogenisieren und zu einer – nicht nur gedachten – Komplexität zu führen. Er unterrichtet auch an der Technischen Universität Graz und Peter Reischer unterhielt sich mit ihm über Lehre, Sinnfragen und einen interessanten Vorschlag zur ‚Stadtreparatur‘.
Was bedeutet für Sie - ‚Sprechen über Architektur‘?
Welchen Sinn sehen Sie in dieser ‚Gesprächsreihe‘?
Für mich ist das jetzt schon der dritte oder vierte Vortrag in dieser Reihe. Ich werde so alle 3 - 4 Jahre eingeladen, was mich natürlich zur Frage führt, was erzähle ich diesmal?
Am Anfang waren es die ersten, realisierten Projekte, beim zweiten Mal war es ein Werkbericht und nun ...?
Ich bin im Moment – nach 25 Jahren Beruf und Büro – in einer Umdenkphase, einer Orientierungsphase.
Eine Neuorientierung?
Es gibt bestimmte Themen, die einen interessieren. Das ergibt sich aus der Ausbildung und der persönlichen Entwicklung: Da sind räumliche Aspekte, Zusammenhänge mit Licht und Orientierung – die sind ‚stabil‘.
Dann gibt es die Frage, was bedeutet mir Architektur, das Bauen, worum geht es da eigentlich - diese Haltungen ändern sich durchaus.
Was hat sich bei Ihnen da in den letzten Jahren verändert?
Das beginnt gerade erst. Ich kann nicht sagen, dass es eine eindeutige Entwicklung gibt. Wir haben einige Projekte, mit denen man zufrieden sein kann, realisiert. Aber es taucht die Idee auf, konsequenter, um nicht zu sagen: radikaler, zu werden.
Könnte man das eine Suche nach einem Mehrwert nennen?
Nein, es ist eher so, dass die Architektur – auf einer bestimmten Ebene – als Profession am Ende ist. 15 Jahre lang haben die Einen gesagt, wir sind Dienstleister – jetzt sind wir es wirklich. Andere waren auf der Suche nach dem ‚neuen Raum‘ – die Architektur muss fliegen, schweben. Die Nächsten sagen, die Architektur muss energieeffizient, sozialverträglich, ökologisch sein. Irgendwann muss man aber einsehen, dass Architektur das alles zusammen nicht leisten kann.
Für mich ist jetzt dieser Moment gekommen. Das Bauen ist dermaßen überfrachtet mit Dingen, die damit nichts mehr zu tun haben. Ich fülle nur mehr Listen aus.
Sprechen Sie damit die Überforderung durch Normen, Gesetze, Nachhaltigkeitszertifikate und Richtlinien etc. an?
Ja, aber es gibt auch andere Forderungen: Wir als Architekten müssen zum Beispiel den öffentlichen Raum organisieren ...
Die Frage ist: Was leistet ein Gebäude. Das hat mit der architektonischen Form nichts mehr zu tun, sondern ist nur mehr eine Folge von Programmen und Einflüssen, die von irgendwoher kommen.
Das ist doch ein Prozess, der sich – reflektierend betrachtet –über einige Zeitspannen zieht?
Ja, da liegt einiges in der Luft. Eine zentrale Frage im Moment ist, was können Typologien in der Architektur leisten? Es gibt international ganz wenige Architekten, bei denen neue Typologien entstehen. In der Lehre in Graz haben wir zwei Vorlesungen, die sich fast ausschließlich mit Grundrisstypologien befassen. Die Studierenden sollen lernen, sich mit dem Grundriss auseinanderzusetzen, nicht nur Bilder zu konsumieren.
Wenn ich jetzt provokant behaupte: Architektur ist nur noch Bild, ist Schein?
Es gibt eine Strömung, die das vermuten lässt – ja! Wenn es nur mehr eine Serie von Stützen, einen Raster, die Geschossdecken gibt und die Hülle, die als Bild funktioniert. Das kann dann ein Hotel oder ein Shoppingcenter sein.
Was ist mit den spektakulären Bildern von Architektur, wie sie hauptsächlich in den Medien transportiert werden? Damit verbinden doch die Menschen heutzutage die Vorstellung von ‚Architektur‘.
Damit lässt sich natürlich Architektur leicht transportieren und als Architektur verkaufen. In diesem Sinne ist sie auch am Ende. Da funktioniert sie nur mehr als Marketinginstrument. Diese Bauten werden hauptsächlich in Regionen errichtet, die damit Werbung für sich machen wollen, die Aufmerksamkeit erregen wollen.
Peter Sloterdijk hat ja den Menschen auch als ‚homo nocturnus‘ (der Mensch braucht seinen Schlaf, um zu überleben) bezeichnet und gemeint, dass in diesen Anhäufungen moderner Prachtbauten keinerlei Nachtleben im Sinne der ‚Schlafimmunität‘ mehr zu finden sei. Ist also unsere Architektur sehr segretativ und funktionslastig geworden?
In gewisser Weise schon. Diese extreme Ausformulierung von Funktion ist ein Problem. Das hat in den Städten nicht funktioniert und es funktioniert im Gebäude auch nicht.
Das ist auch ein Punkt, mit dem wir uns in der Lehre beschäftigen – die Verdichtungsfrage. Sie wird ganz stark durch die Überlegung motiviert, dass seit dem Ende des 2. Weltkrieges in Österreich nicht mehr Städtebau, sondern nur mehr Siedlungsbau betrieben wird. So kann keine Stadt entstehen!
In Graz versuchen wir so etwas wie ‚Stadtreparatur‘: Was müssen Gebäude, die nicht explizit Wohnraum oder Büro sind, können? Gebäude, die etwas zur Verfügung stellen, das – ohne in ´Sozialromantik zu verfallen – genutzt werden kann.
Wie kann man bei der Stadtreparatur eine Wertung treffen im Sinn von ‚reuse, reduce or recycle‘?
Abbrechen, Neubauen oder Umnutzen, das ist eine Entscheidung der einzelnen Siedlungen. Viele dieser Siedlungen haben wunderbare Grundrisse, die man heute gar nicht mehr so bauen könnte, aufgrund der heutigen Gesetze. Das Problem ist immer das Erdgeschoss, was kann man da machen.
Das ist die Zone des Lebens!
Ja, das ist die entscheidende Frage. Gibt es Öffentlichkeit, kann man das organisieren?
Und dann geht es um eine Art von räumlicher Fassung.
Öffentlichkeit im Stadtraum - also eigentlich der Negativraum zwischen den Häusern?
Genau!
In Graz haben wir sämtliche Gründerzeitviertel, also die gesamte Blockrandbebauung untersucht – die funktioniert ja sehr gut. Unsere Idee war, die gesamte Dachfläche um zwei Geschosse (das ist ungefähr die jetzige Firsthöhe) aufzustocken. Dabei hat sich herausgestellt, dass man damit den gesamten Wohnraumbedarf der Stadt Graz für die nächsten 15 Jahre abdecken könnte. Und zwar in einer Gegend, in der die Infrastruktur bereits vorhanden ist und es eine soziale Durchmischung gibt. Es würde dann auch genug Dichte geben, damit die Erdgeschosszone leben kann.
Warum macht man das nicht?
Da kommt die politische Dimension dazu. Für einen Teil der Politik ist das unvorstellbar.
Warum ist das unvorstellbar, funktioniert das Denken bei den Politikern nicht mehr?
Es funktioniert insofern nicht, weil sie sofort an die Widerstände denkt, die da reflexartig kämen. Weil für die Meisten die Gründerzeit eben die historische Altstadt ist. Dabei ist das nichts anderes als Spekulationswohnbau von vor 120 Jahren.
Im Grunde werden irgendwelche Dachausbauten genehmigt, die dann mehr oder wenig lächerlich das Thema Dach interpretieren. Unsere Idee war, nicht das einzelne Haus, sondern die gesamte Dachfläche der Stadt als Aufstockungspotenzial zu betrachten. So könnte ich Wohnraum als eine echte Alternative zum Einfamilienhaus am Stadtrand, anbieten. Es entsteht eine neue ‚Dachzone‘, auf der ich Gemeinschaftsflächen, betreutes Wohnen, Grünräume anbieten kann. Man könnte - im Gesamtbild - auch die Energiebilanz dieser Häuser verbessern, weil man nicht die Gründerzeit mit Styropordämmung verschandelt, sondern die oberen Ebenen dem Gesamtvolumen zurechnet. Die Grünflächen in den Blöcken müssten der Hausgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden und alle sind an der Aufwertung (auch finanziell) beteiligt. Langfristig gesehen ist das sicher ein Modell, das funktionieren kann.
Der nächste Schritt nach der Verdichtung der Gründerzeit ist dann die Siedlungsentwicklung außerhalb der Stadt. Das ist in Wien nicht so eindeutig wie in Graz abzulesen. In den nächsten Jahren werden wir uns in der Lehre in Graz ganz stark mit dem Stadtrand befassen.
Ein weiteres Thema für die nächsten Semester ist es, mit großformatigem Wohnbau – 1.000 Wohnungen – zu experimentieren, das zu untersuchen. Wie reagiert die Umgebung, wie reagiert man selbst bei diesen Größenordnungen?
Wie stehen Sie persönlich zu solchen Dimensionen?
Das ist eigentlich schwer vorstellbar.
Warum, welche Bedenken haben Sie?
Erstens und logischerweise der Maßstab. Das ist etwas, das mir als Person, unabhängig ob Architekt oder nicht – fremd wäre. Es gibt so etwas, wie einen europäischen Maßstab. Das sind die ca. 20 – 22 Meter Höhe, das funktioniert in Mailand und in Wien, das sind wir gewohnt.
Für mich sind 1.000 Wohnungen eine spannende Frage, kann ich damit einen Ansatz schaffen, der bestimmte Themen lösen kann? Die Frage ist nicht einfach mit ja oder nein zu beantworten. Ich habe mir abgewöhnt, sofort eine Meinung zu etwas zu haben. Es geht darum, auszuprobieren, wie lassen sich Grundrisse in einer solchen Struktur lösen und immer auch um die Frage der Erdgeschosszone.
Warum haben Sie sich für das Architekturstudium entschieden? Sie haben Bezug zum Land, zur Natur?
Der Auslöser war sicherlich die Kirche von Domenig/Huth, die sie in Oberwart – dort bin ich aufgewachsen – gebaut haben. Beton in einer brutalen Form – etwas völlig Fremdes und Faszinierendes!
In Ihren gesamten Arbeiten ist kein traditionelles Dach zu finden? Warum nicht?
Wir finden kaum Bauaufgaben vor, wo das ein Thema wäre. Dächer definieren tendenziell eine Richtung, die Giebel- und die Traufseite, das hat mich sehr lange gestört, weil wir bei Grundrissen eher richtungslos agieren wollen – das ergibt immer einen Widerspruch. Ich bin aber sicher kein ‚Dachverweigerer‘.
Welcher Architekturrichtung, wenn man das so sagen kann, würden Sie sich zuordnen?
Vor zehn Jahren hätte ich die ‚Klassische Moderne‘ genannt, heute sage ich das nicht mehr.
Es gibt mehr als 2.000 Jahre Architekturgeschichte, ich muss mich nur halbwegs darin auskennen und bewegen, da kann ich auf so viel zurück- und zugreifen. Das fasziniert mich im Moment extrem stark. Das ist eine Entdeckungsreise durch Dinge, die ich während des Studiums nie kennengelernt habe. Architekturgeschichte war damals verpönt.
Das Erbe der ‚Klassischen Moderne‘ – zu der Sie sich ja zumindest anfänglich zuordnen würden – was nehmen Sie davon mit?
Für mich hat die Transparenz Gültigkeit, die starke Verbindung zwischen innen und außen, eine bestimmte Art der Auflösung – von dem kann man sich nicht so leicht trennen.
Sie haben sich sehr viel mit Bestandserweiterungen, Zubauten und Umnutzungen befasst. Ist heute das Neufinden von Nutzungen und Funktionen in der Architektur nicht wesentlicher als Neubauen selbst?
Zumindest genauso wichtig!
Hans Gangoly
Geboren 1959 in Oberwart, Burgenland, Studium der Architektur an der Technischen Universität Graz
Diplom 1988 mit Auszeichnung.
Seit 1994 aufrechte Befugnis mit Kanzleisitz in Graz
1996–1999 Vorstandsmitglied der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs – Landesverband Steiermark, seit 2007 Professor am Institut für Gebäudelehre der Technischen Universität Graz.
2007 Gründung der Gangoly & Kristiner Architekten ZT GmbH