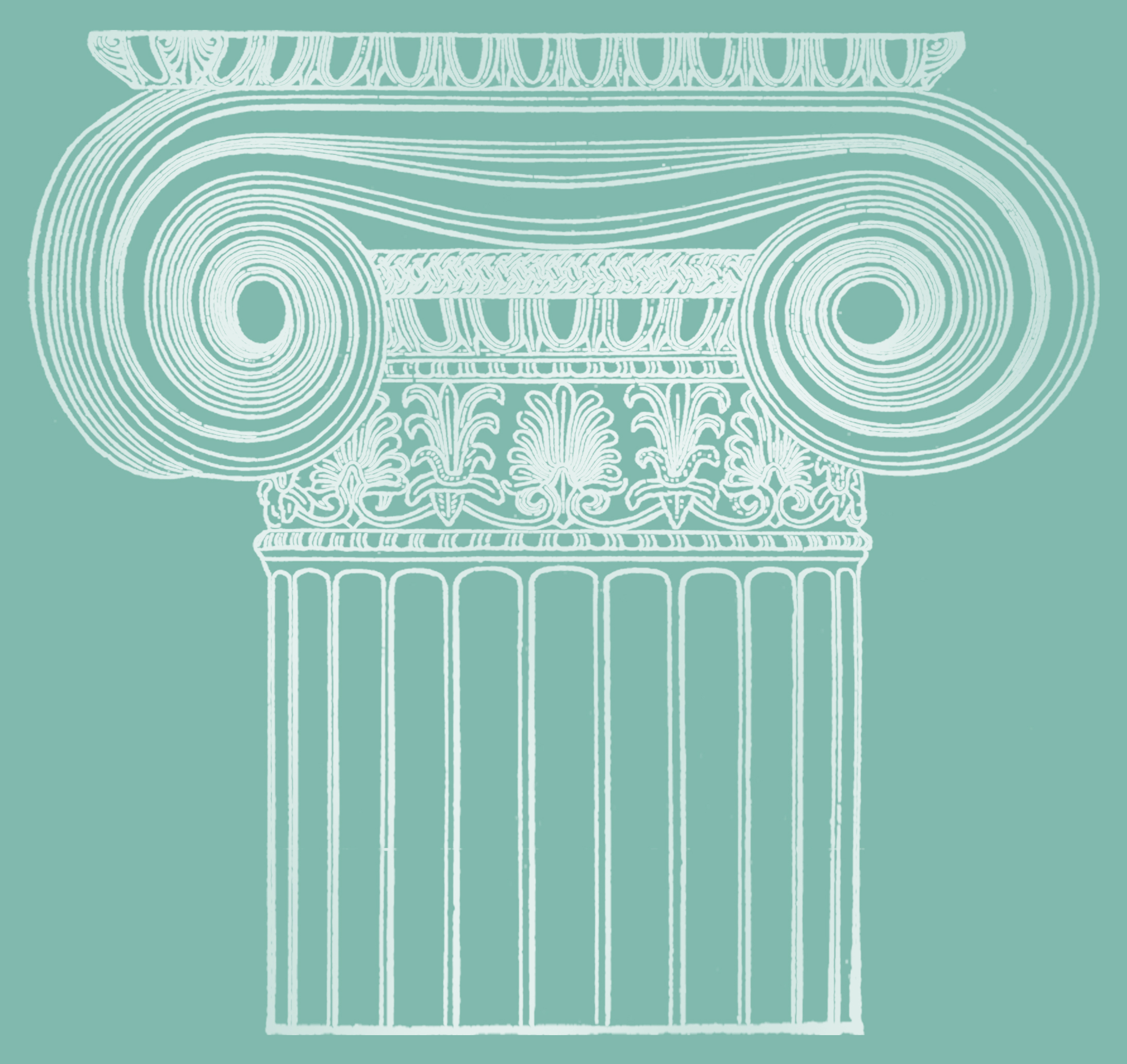gaupenraub+/-
IF YOU THINK GOOD ARCHITECTURE IS EXPENSIVE, TRY BAD ARCHITECTURE!
Alexander Hagner, geb. 1963 (D) absolvierte nach der Matura eine Tischlerlehre, anschließend das Architekturstudium an der Universität für angewandte Kunst/Wien, Meisterklasse Prof. Johannes Spalt und Meisterklasse Prof. Wolf D. Prix (Coop Himmelb(l)au)
Seit 1997 arbeitet er selbstständig in Wien, 1999 gründete er gaupenraub gemeinsam mit Ulrike Schartner
Ulrike Schartner, geb. 1966 (A) studierte nach dem Abschluss eines Kolleg für Innenausbau und Möbelbau Architektur an der Universität für angewandte Kunst in Wien, Meisterklasse Prof. Johannes Spalt und Meisterklasse Prof. Wolf D. Prix (Coop Himmelb(l)au) sowie an der KTH/ Stockholm.
Seit 2000 ist sie selbstständig in Stockholm und Wien tätig.
Da sich die beiden Bürogründer Alexander Hagner und Ulrike Schartner von Beginn an zugunsten sozial engagierter Projekte weigern, an offenen Wettbewerben teilzunehmen, bestanden die ersten Arbeiten überwiegend aus kleineren aber zumeist realisierten Direktaufträgen aus den Bereichen Design, Innenarchitektur und vor allem Sanierungen, Um- und Zubauten. 2006 erfährt diese Arbeit mit der Auswahl von gaupenraub in die erste Staffel von Young Viennese Architects (YoVA1) erstmals eine größere öffentliche Resonanz.
Inzwischen wurden Projekte von gaupenraub z. B. mit dem Architekturpreis des Landes Burgenland 2010 und dem ETHOUSE Award 2011 ausgezeichnet, zum Mies van der Rohe Award 2011 nominiert und zuletzt erhielt ihr Wiener Projekt ‚VinziRast-mittendrin‘ in Berlin den europaweit ausgeschriebenen URBAN LIVING Award 2013.
Wer jemals 2 Meter unter einer dahindonnernden U-Bahn gesessen hat, kann sich die Atmosphäre im Atelier von gaupenraub+/- vielleicht vorstellen: der erste Stadtbahnbogen an der Westeinfahrt von Wien, alle 2 Minuten ein Zug über dem Ziegelgewölbe. Abgesehen vom Lärm ist aber alles sehr stimmig, hat Flair. Peter Reischer wagte den Besuch und war von den zutiefst menschlichen und sozialen Intentionen der beiden Architekten sehr überrascht.
Sie beide haben einander an der Angewandten kennengelernt? Hat die Zusammenarbeit auch dort begonnen?
Ja, wir haben dort zeitgleich zu studieren begonnen, das war zu dem Zeitpunkt, als Prof. Spalt es endlich geschafft hatte, die Innenarchitektur in eine Architekturklasse zu verwandeln. 1987 haben wir begonnen und immer wieder Studentenprojekte zusammen gemacht. Es war auch manchmal ein Wettbewerb dabei. Ganz am Anfang, die ersten Tage und Wochen konnten wir uns nicht ausstehen, das hat sich dann gegeben und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich ganz gut zusammenarbeiten können.
Sind Ihre sozialen Projekte in der Architektur der Ausdruck eines Wunsches nach einer sinnvollen, konstruktiven Betätigung?
Man darf sich nicht dem Gedanken ‚es ist alles so schlimm in unserer Welt und ich kann gar nichts machen‘ hingeben. Ich kann etwas machen - wenn ich will! Es geht auch darum, die eigene Machtlosigkeit zu ersetzen.
Das ist für uns auch in der Architektur ganz wesentlich. Wir warten nicht, bis jemand kommt, sondern wenn wir Problemstellungen und Handlungsbedarf sehen, dann werden wir aktiv. Wir verweigern uns offenen Wettbewerben, weil wir das als Katastrophe für die Architekten sehen. Man darf sich gar nicht überlegen, wie viel Arbeit und Arbeitsstunden da pro Jahr ungefragt und ungesehen in den Mistkübel wandern. Wenn wir an solchen Wettbewerben teilnähmen, könnten wir Projekte wie die VinziRast nicht machen. Wenn allerdings mehr Ateliers so arbeiteten wie wir, gäbe es wahrscheinlich mehr sinnvollere Projekte im Sozialbereich.
Wie sind Sie zu diesen Projekten gekommen?
2002 kam Pfarrer Pucher mit der Idee ein VinziDorf zu machen nach Wien. Ich habe davon gelesen, habe ihn angerufen und gefragt, ob er Architekten brauchen kann. Seit dieser Zeit probieren wir das Projekt in Wien zu realisieren. Das VinziDorf beruht auf dem Prinzip des maximal Niederschwelligen. Es geht um Menschen, die in der Isolation leben, die nicht einmal mehr von anderen Obdachlosen akzeptiert werden, die also völlig aus jeder Art von Gemeinschaft herausgefallen sind. Denen wollen wir zumindest ein Angebot machen können.
Das VinziDorf Graz gibt es jetzt seit 20 Jahren mit Erfahrungen in der Kommunikation mit Anrainern. Mit Erfahrungswerten aus dieser ganzen Zeit, wie groß die Gruppen sein müssen, was man ihnen bieten muss etc. Wenn man nun in Wien mit dem Bürgermeister Häupl oder anderen darüber redet, erhält man zur Antwort: ‚Wien ist eben anders‘, was in Graz funktioniert, muss in Wien nicht auch funktionieren.
Und damit stehen wir bei dem Projekt VinziDorf noch dort, wo wir vor 12 Jahren waren, beim Projekt Notquartier-Hetzendorferstraße kommen wir seit 6 Jahren nicht weiter.
Wenn jemand obdachlos ist, ist das doch egal, ob er es in Nürnberg, Berlin, Wien oder Graz ist. Da kann es doch nicht um politische Befindlichkeiten gehen?
Genau, es geht darum, dass er kein Zuhause hat.
Leider haben wir herausgefunden, dass unsere Gesetze, Richtlinien, Normen und die Bauordnungen solche Projekte verhindern. Niederschwelligkeit und die Mindeststandards die die Bauordnung fordert - haben miteinander nichts zu tun. Wenn ich einen Obdachlosen, der unter einer Brücke Unterschlupf sucht, als Bauherrn ernst nehme - dann kann ich ihm kein Heim anbieten. Ich muss ihm etwas bieten, das er wahrnehmen kann. Ob er es annimmt, ist wieder eine andere Sache.
Uns als Architekten interessiert der Begriff ‚Minimal Housing‘, Wohnen für jemanden, der das Wohnen eigentlich verlernt hat. Wenn ich für diesen ‚Kunden‘ Architektur generieren will, brauche ich keine 2,50 Meter Mindestraumhöhe und keinen K-Wert, die sanitäre Anlage innerhalb der Einheit oder ein barrierefreies Bad.
Liegt das Problem nicht darin, dass die Stadt, dass die Menschen solche Obdachlose nicht sehen wollen? Dass eben im Stadtpark nicht kampiert werden darf?
Ich weiß nicht, warum es den Menschen unangenehm ist, einen ‚Sandler‘ unter Zeitungen bedeckt, liegen zu sehen. Mir ist es auch unangenehm. Es ist vor allem unangenehm, zu sehen, dass Menschen leiden, das ist etwas Ursprüngliches. Es ist das Gefühl der Hilflosigkeit.
Jemandem zu helfen, ist schwieriger, als zu sagen: Ich schaue weg.
Das glaube ich auch. Wenn man anfängt, sich zu engagieren, liefert man sich auch Vorwürfen, auch eigenen Vorwürfen aus: Die Hilfe, die wir geben, ist aber immer zu wenig.
In dieser Hinsicht sind wir degeneriert, weil wir zunehmend Verantwortung nicht mehr selbst wahrnehmen bzw. selbst dort abgeben wollen, wo es um menschliches Leid in unserer direkten Nachbarschaft geht. Und dieser Prozess schreitet voran, wird immer ärger. Wenn Afrikaner über Community reden, dann geht es um eine empfundene Verantwortlichkeit, auch quer durch die Hierarchien der gesellschaftlichen Schichten. Bei uns gibt es keine Bewegungsfreiheit zwischen legal und illegal, die Grenze ist scharf. Aber einen Spielraum dazwischen müssen wir wieder schaffen und den könnte man Eigenverantwortung nennen.
Bei uns ist ein Fußabstreifer, der 0,8 m² in den öffentlichen Raum ragt ein Problem. Niemand kann den Grund dafür nennen, aber er wird einfach verboten, bzw. nicht erlaubt.
Wie ist Ihr Ateliername gaupenraub+/- entstanden?
Wir hatten ein Projekt, bei dem es darum ging zugunsten einer großzügigen, neuen Lösung, die bestehenden Dachgaupen zu entfernen. Da hat die Bauherrin gemeint, wir seien ja Gaupenräuber, und da wir gerade auf der Suche nach einem Namen für unser Atelier waren, ist das geblieben.
Was wollen Sie damit aussagen? Überraschung, Neugierde, Provokation?
Wir mögen künstliche, additive Lösungen nicht. Wir sind ein offenes System. Meine Partnerin war lange Zeit das Minus, weil sie gleich nach Beginn mit ihrem Mann nach Schweden gezogen ist. Wir sind ein Team, bei dem einmal mehr und einmal weniger Leute mitarbeiten.
Sie eröffnen im Jänner die Reihe ‚Sprechen über Architektur‘. Was werden Sie über Architektur sprechen? Kann man über Architektur sprechen? Oder muss man sie machen?
Das ist eine große Diskussion. Wir haben schon überlegt, keine Bilder zu zeigen, nur zu sprechen. Bilder sind als Transportmittel für Architektur nur sehr bedingt geeignet. Architekturvermittlung ist sehr schwierig, weil Texte die Architektur nicht erfassen können. Und Bilder erfassen sie auch nicht. Architektur muss man eigentlich räumlich selbst erleben.
Dann ist für Sie die Architektur eher das Medium als ein Resultat?
Bei der VinziRast freut mich wahnsinnig, dass die Architektur als Transporter funktioniert und funktioniert hat. Als Transporter für eine politische Idee. Und zwar, dass wir in der Gesellschaft nicht den Kontakt von oben nach unten und unten nach oben verlieren dürfen. Wir wollten kein Sozialprojekt machen, oder ein Projekt, das sich so anfühlt oder danach riecht. Wir wollten Menschen ansprechen, die keine ‚soziale Ader‘ haben, die müssen nicht einmal wissen, dass da Obdachlose und Studenten zusammenleben und wohnen. Es geht um das Schwellenthema, diese Schwellen zu nivellieren, die Grenzen zu verwischen, Zwitterzonen zu schaffen.
Wie würden Sie sich als Büro einem Kunden darstellen? Welche Selbstbeschreibung würden Sie abgeben?
Wir machen alles, vom Minidesign eines Produktes, bis hin zu städtebaulichen Konzepten und Studien. Wir glauben, dass diese unterschiedlichen Maßstäbe sich gegenseitig befruchten. Wir konzentrieren uns auf sehr spezielle Lösungen. Bei einem ‚Eiermuseum‘ kann man nicht im Neufert nachschlagen.
Sie haben Ihr Atelier unter einem Stadtbahnbogen an der Westeinfahrt von Wien. Eher eine Situation, wo man ein Lager oder einen Abstellraum erwarten würde, nicht ein Architekturatelier. Ich sehe darin auch eine Betonung Ihrer ‚Ideologie‘, ein bewusstes Understatement.
Das war auch ein ‚Probieren‘. Wir hätten damals zwei Bögen mieten können, leider habe ich mich damals nicht getraut, heute könnten wir den Nachbarbogen gut brauchen. Wir wussten gar nicht, ob es möglich sein würde, hier ein Büro zu machen - die laute Westeinfahrt von Wien, die U-Bahn alle paar Minuten ... also haben wir es ausprobiert.
Unser Atelier ist jetzt auch ein ‚Bauherrnfilter‘.
Wie ist das bitte zu verstehen?
Wir haben anfangs die Erfahrung gemacht, dass Leute zu uns hereingekommen sind - die fanden das ganz komisch. Ein Architekturbüro ist meistens ein Loft oder Ähnliches, weiß, großzügig. Wir haben hier ein Gewölbe, es regnet an den Rändern herein und tropft. Mit diesen Bauherrn sind wir nie zurande gekommen. Darum schauen wir genau, wie Kunden oder Bauherrn das erste Mal zu uns hereinkommen.
Wo ordnen Sie sich im Architekturgeschehen ein?
Eigentlich gar nicht!
Wo liegt der Schwerpunkt Ihrer Arbeiten?
Bei Umstrukturierungen und Ergänzungen.
Was bedeutet für Sie der Zeitfaktor in der Architektur?
Wir erzählen Geschichten weiter, das ist eine Form der Kontinuität. Es gibt für uns als Architekten keine schlimmere Situation, als die grüne Wiese, wo alle verzweifelt auf der Suche nach Identität sind, wo man bei Null beginnen muss.
Noch eine Frage zur ‚Zeit‘: Wenn man in 20 Jahren rückblickend unsere heutige Architektur betrachtet - wo liegen die Probleme der heutigen Architektur?
Also eine Stilrichtung haben wir heute keine - neue Gebäude mit Stil gibt es zum Glück schon noch. Meiner Meinung nach liegen die Probleme darin, dass die Architektur nicht ernst genommen wird, nicht in dem Maß, in dem sie jedenfalls ernst genommen werden sollte. Es fehlt ihr die ‚Wertbeimessung‘.
Gesellschaftlich oder politisch?
Beides. Sie kann mehr, sie ist für mehr verantwortlich, sie ist eben nicht nur Hülle für etwas. Sie war immer ein Mittel, um den Hochstand einer Kultur sichtbar zu machen. Sie hat eine Aufgabe, die über die Hülle hinausgeht. Sie soll unseren Alltag formen, nicht reagierend, sondern leitend. Wenn jemand der Art, in der er Architektur generiert, eine Bedeutung beimisst - das wird als Luxus betrachtet. Das ist es aber nicht, im Gegenteil, es ist eine Notwendigkeit.