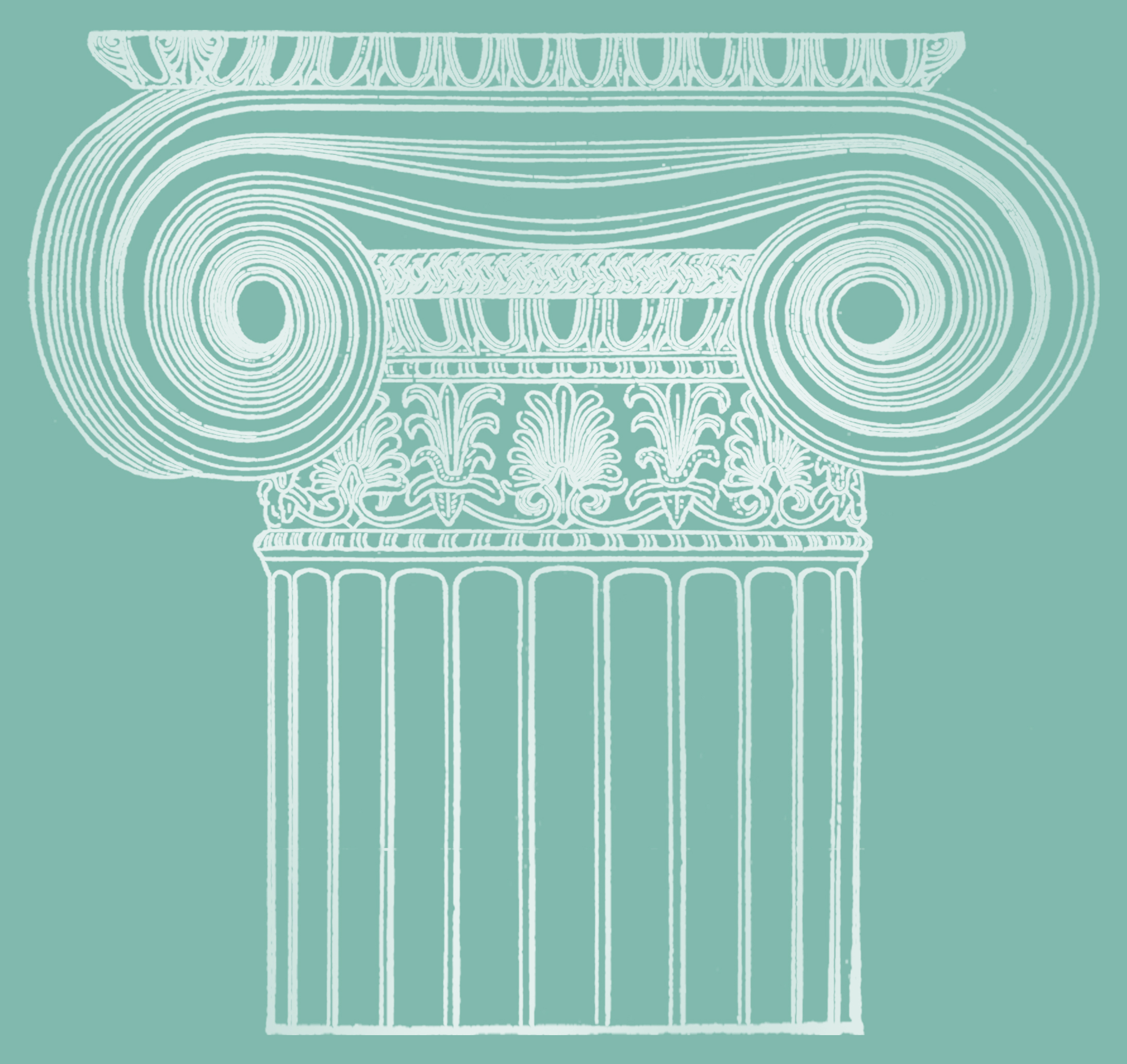Erich Steinmayr
ARCHITEKTUR UND MUSIK
Er beherrscht die Zurückhaltung, die Einordnung perfekt. Seine Arbeiten enthalten Feinheiten, die oft übersehen werden. Peter Reischer unterhielt sich mit Architekt Erich Steinmayr über seine Liebe zur Musik, über Architektur und über das Wiener ‚Aufregerthema‘ der letzten Zeit, das Wettbewerbsergebnis WEV/Interconti.
Das ist nun schon der 3. Vortrag, den Sie in der Reihe ‚Sprechen über Architektur‘ halten - ist das schon so etwas wie ein Heimspiel für Sie?
Der Erste war 1992, da war bei uns gerade alles im Wachsen, neue Projekte, meine Architekturvorlesung in Innsbruck, Einladungen etc.
Der zweite Vortrag war 2001 vor der Fertigstellung der Albertina – das war bei diesem Vortrag natürlich ein pragmatischer Schwerpunkt.
Jetzt, nachdem ich neuerlich eingeladen bin, dachte ich mir: Wie machst du das diesmal?
Ich möchte jetzt die Positionen darstellen, die für unsere Arbeiten in den letzten 15 – 20 Jahren und bis heute wichtig waren und sind.
Um was handelt es sich dabei?
Ich bin, meine ich, grundsätzlich ein struktureller Denker. Wenn man zum Beispiel die einzelnen Betrachtungsebenen von Christian Norbert Schulz (norwegischer Architekt und Theoretiker) zugrunde legt, dann war es uns immer wichtig, dass sich die Basisphänomene – der funktionelle Rahmen, die Ortsanalysen, die Milieustudien – bei unseren Projekten auf allen diesen Ebenen manifestieren und auch die Form sich so generiert.
Wir – wie auch die meisten Architekten – gehen primär von einer Analyse des Ortes aus. So beginnend versuchen wir die Entwurfsthemen – sowohl innen als auch außenräumlich – auf möglichst vielen Ebenen zu belegen. Das heißt, es entstehen nicht zufällige Formen.
Wie entsteht z. Bsp. eine Gebäudehülle in Korrelation mit dem Sonnenlicht, mit dem direkten Tageslicht, mit der Ausblendung desselben. Das sind einige der instrumentellen Aspekte der Formgenese.
Das sind ja durchaus Ansätze einer Nachhaltigkeit?
Wir sind zwar bei gegenwärtig entstehenden Bauten nicht so rigoros wie vor Jahren, aber diese Vorgangsweise ist uns wichtig. Beim Studiengebäude der Albertina sind zum Beispiel die Vertiefungen der zurückversetzten Fenster, die die Nachmittagssonne ausblenden, im Westen schwarz und im Osten natureloxiert. Diese Präzision der Gebäudestrukturierung hat mich immer schon sehr interessiert.
Sie wollen beim Vortrag über die Affinitäten/Ähnlichkeiten bei der Konzeption von Architektur und Musik sprechen. Wie ist das zu verstehen?
Eine gute Frage, ich komme aus einer Musikerfamilie und bin selbst Musiker. Ursprünglich wollte ich Musik und Architektur parallel studieren, habe aber den Gesamtaufwand bei qualitätsvoller Beendung beider Studien wohl etwas unterschätzt. Ich habe in Graz studiert, einem damaligen Zentrum des Jazz. Über die Liedbegleitung bin ich beispielsweise auch zu Schumann gekommen – das ist bis heute wichtige Musik für mich, von ihr habe ich mehr gelernt, als von vielen Werken der Architekturtheorie.
Mathematik, Architektur, Musik - ist es möglich, aus Klang Räume zu erschaffen?
Das sind natürlich völlig verschiedene Phänomene, aber beide gehen mit dem Raum, der Zeit um. Für beide benötigt es strukturelles Denken, für Rhythmus, Klangstrukturen und deren Proportionen. Obwohl die Musik ein sehr flüchtiges Medium ist und sofort nach der Entstehung wieder verschwindet, die Architektur sich dagegen sehr stabil manifestiert, gibt es eben diese Korrelation von Proportion und Rhythmus. Das kann man auf den verschiedensten Ebenen verfolgen. Schumanns fantastische Rhythmusverschiebungen, seine Synkopen sind etwas, das einen unmittelbar betrifft. Es hat auch für räumliche Phänomene – für mich – sehr viel Bedeutung. Wie setzt man Dinge hintereinander, wie oft kann man sie wiederholen, soll man sie wiederholen, variieren?
Kann man Architektur nach Musik entwerfen? In „Bloch City“ entwirft Peter Cook/Archigram auf den Notenlinien eines Musikstücks von Ernst Bloch eine Stadt.
Oder ist Musik und Architektur eher eine metaphysische Allegorie?
Ich würde es eher bei der Korrelation von Raum- und Klangphänomenen belassen, statt da konkrete Affinitäten zu schaffen. Mein Zugang zur Musik bezieht sich eher auf Proportionen, Struktur. Bei der Architektur merkt man z. Bsp. auch sofort, wie in der Musik (die Kleinlichkeit bei manchem Modulationen Schumanns) – wenn es kleinlich und dünn wird. Ich habe zum Beispiel einmal einen Architekturvortrag in Vaduz gehalten und anschließend Klavier gespielt mit dem Ziel, Raum- und Klangphänomene unmittelbar nebeneinander zu stellen.
Schon Vitruv forderte zur angemessenen Ausbildung des Architekten auch die Kenntnis der Musik.
Ich glaube auch, dass das wichtig sein kann.
Wie weit fließt diese Beschäftigung in Ihre Architektur hinein?
Einfließen lasse ich in erster Linie die gesamtheitliche Betrachtungsweise, die dadurch entsteht. Für mich ist die tonale Skizze, improvisatorische Musik das Wichtigste geworden. Die ist durch meinen Kontakt mit der Grazer Jazzszene während des Studiums entstanden. Wir haben bei der Ausbildung die letzten Bauhäusler und Werkbündler erlebt, denen der Bezug Architektur - Musik wichtig war. Ich bin zwar kein Freejazzer geworden, habe aber gemerkt, dass mir improvisatorische Klanggenese liegt. Mich interessieren gegenwärtige aber auch sehr die späten Klavierwerke von Schubert, oder auch große Teile der Musik Schumanns – mit diesen beschäftige ich mich auch theoretisch heute mehr als vor Jahren.
Betrachten Sie sich selbst eigentlich als einen Vertreter der ‚klassischen Moderne‘?
Ja, ich denke schon! Wenn man die Entwicklungen bis zur Gegenwart mit einbezieht, ist das sicher so.
Wie wollen Sie bei Ihrem Vortrag über Architektur sprechen?
Ich habe mir ein paar Leitsätze ausgearbeitet: Das Erste ist, wie entsteht bei uns Struktur und Form. Wie lässt sich die Form auf mehreren Denkebenen sinnvoll erfüllen und belegen.
Das Zweite sind Gedanken über die Reaktion am Ort, seine Geschichte, Kontext. Was ist dabei wichtig, was macht das aus, was wir unter Kontext verstehen.
Sie haben ziemlich viel am Volumen der Albertina mitgestaltet: Wie fühlen Sie sich, wie empfinden Sie den Gesamteindruck im Anbetracht der vielen verschiedenen Handschriften? Ist ‚Mehr‘ oder ‚Weniger‘ mehr?
Uns ist und war natürlich immer ‚Weniger‘ mehr. Die wichtigsten Teile der Albertina sind für uns das Studien-, das Forschungsgebäude, das Logistikzentrum, das Dahinter bis zur neuen Ausstellungshalle. Das war auch der wesentliche Inhalt des ersten Wettbewerbes. Das Projekt ist in der weiteren Projektentwicklung zudem immer größer geworden. Zum Beispiel die Überglasung des Courts.
Einige Entscheidungen waren schwierig – der radikale Umbau der alten Albertina zum Beispiel. Das ist mit der Notwendigkeit der Schaffung von Ausstellungsräumen verbunden, die für das neue Ausstellungskonzept erforderlich waren.
Was halten Sie von den gestikulierenden Auswüchsen mancher Architektur, ich meine da eher den Wohnbau?
Ich muss da Roland Rainer wiederholen – der Wohnbau ist für solche Sachen zu schade. Ich bin oft erschüttert, wenn ich an vordergründig zeitgeistigen Wohnbauten, wie dem von Zaha Hadid vorbei fahre – das dient dem Wohnbau nicht.
Ist bei Ihnen eine Liebe zum Untergrund, zum ‚in die Erde eingraben‘ zu bemerken? (Rathaus und Bauamt - Erweiterung Lustenau, Albertina)
Das ist Zufall, ich habe das nicht gesucht. Aber wenn man einen affinen Gedanken dazu entwickeln möchte – da spielt natürlich meine Haltung zur Architektur auch eine Rolle – dann kommt das daher, dass uns das richtige Augenmaß bei der Gewichtung des Baukörpers wichtig ist. Ein Beispiel ist eben das Studiengebäude des Albertinamuseums, das sich unterordnen und in den Reigen der umgebenden, dienenden Gebäude, in den Kontext stellen muss.
Beim Wettbewerb am Heumarkt war dasselbe schwierig: Da gab es ein Projekt, das fast sieben Geschosse unter dem Niveau positioniert ist. Was bei einem Hotel natürlich nicht geht.
Sie haben jetzt die perfekte Überleitung zum ‚Aufregerthema‘ der letzten Zeit geschaffen. Sie waren der stv. Vorsitzenden des Preisgerichts für den Wettbewerb WEV/Interconti. Wie sehen Sie das Ergebnis?
Für mich war am Anfang an diesem Ort ein höheres Gebäude undenkbar. In den sieben Monaten der Beschäftigung mit dem Thema sind wir zu dem Entschluss gekommen – wenn man es ganz gut macht, dann geht es vielleicht.
In der historischen Entwicklung der Stadt waren immer Gebäude, die über die Silhouette hinausgeragt haben, sehr stark semiotisch belegt. In der Gegenwart gilt das in der Form nicht mehr. Das Interconti hat mit dem Konzerthaus auch nichts zu tun, es steht einfach daneben. Das ‚Hochhaus‘ steht nun auch einfach daneben. Es muss weder ein semiotisches Zeichen für das Konzerthaus noch ein solches für das Sportzentrum (WEV) sein.
Halten Sie die Juryentscheidung für ein Fehlurteil? Oder zumindest für fragwürdig?
Bei so einem Wettbewerb mit mehreren Stufen können natürlich in allen Entscheidungsstufen auch Fehler passieren. Das Problem dieses Wettbewerbes war auch, dass sich die qualitätsvollen Projekte, die sich im Wesentlichen in der Silhouette des Stadtkörpers bewegten, nicht machbar waren oder nicht zwingend gebaut werden müssen.
Das Weinfeld-Projekt ist unter den vorhandenen wahrscheinlich das Beste, aber er ist trotzdem der Einäugige unter Blinden. Wie gehen Sie mit der Überschreitung der Baufläche um 1.000 m2 auf das öffentliche Gut/Lothringerstraße um?
Es war in den Wettbewerbsausschreibungen enthalten, dass diese Möglichkeit der Verlegung der Straße mitzudenken ist. Dass die Vorzone des WEV um diesen Boulevard verbreitert wird.
Es gibt doch eine eindeutige Feststellung der Unesco, dass in diesem Gebiet nicht höher gebaut werden darf, sonst verliert Wien das Weltkulturerbe. Wie sehen Sie diese Nonchalance, mit der so eine Tatsache in Wien einfach ‚ausgesessen‘ wird?
In die Jury waren alle wesentlichen Magistratsabteilungen eingebunden. Von der Stadt Wien aus gibt es am Ort keine Höhenbeschränkungen. Der diskutierte Hochhausplan ist in Erarbeitung.
Janos Karasz und auch Dietmar Steiner sprechen im Zusammenhang mit dem Hochhausturm von einem Mehrwert für den öffentlichen Raum. Das ist eine beliebte ‚Architekten- oder auch Politikerformulierung‘. Was verstehen Sie darunter?
Verstanden hat man darunter das Öffnen des Eislaufplatzes, die Schaffung der Vorzone, des Boulevards, die größere Durchlässigkeit am Heumarkt usw.
Dazu brauche ich aber nicht die ganze Aufregung, das geht leichter und billiger auch!
Richtig, das Hochhaus mit dieser Dimension ist ganz eindeutig der wirtschaftliche Hintergrund.
Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass die Umwidmung funktioniert, wenn diese nicht bewilligt wird, kann das Projekt in dieser Form nicht weiter verfolgt werden.
Was ist das für ein Wettbewerb, bei dem eine unabwägbare Voraussetzung Grundlage eines Planungsprozesses ist? Man macht einen Wettbewerb, bei dem man auf die große Unbekannte setzt? Ist das Kalkül?
Das haben wir auch kritisiert. Der Wettbewerb beinhaltet ein paar ganz wesentliche Fragen, die vor so einem Verfahren beantwortet werden müssen. Zum Beispiel die Frage, ob Abbruch oder Weiterbauen des Bestandes. Die unvollständige Abklärung mit dem Iconomos in Korrelation mit der Definition der Stadt Wien - „Es kann auch höher sein“.
In der Fachdiskussion am 5. März 2014 im Hotel Interconti sagten Sie, dass der erste Preis das ‚Weiterbauen im Bestand‘ bringt, im Gegensatz zum völligen Neubau. Meinen Sie damit, dass – provokant gesagt - der ‚Peek&Cloppenburg Stil‘ des Interconti vergrößert und auf den Penthausturm auch noch übertragen wird?
Das Weiterbauen im Bestand hat viele positive, wirtschaftliche Komponenten, wobei ich glaube, dass die Wirtschaftlichkeit des Bestanderhaltes erst gründlich zu untersuchen ist.
Erich Gottfried Steinmayr, geb. 1946 in Feldkirch, Vorarlberg / Österreich, Matura 1965 in Feldkirch
Architekturstudium 1965 - 1973 in Graz / Österreich
Praxis Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Büro in Feldkirch seit 1980
Partnerschaft mit Richard Dünser, Feldkirch
Partnerschaft mit Friedrich Mascher, Wien seit 1993
Steinmayr – Mascher & Partner
Lehrtätigkeiten an verschiedenen Universitäten und Hochschulen
in Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Italien